




| Farbcode | ET-Nr. (laut Quelle) | Länge [mm] |
max. Draht-Ø [mm] |
Federteller [mm] |
Bemerkung(-en) |
| 2 x weiß | 7H5 511 115N |
250-255 | 21,0 | 162 | "Vorher" Serienzustand bei mir |
| 2 x blau | 7H0 511 115AN | 270 | 20,0 | 110 | Gemessen von Ebayer |
| 1 x grün, 1 x orange | 7E0 511 115F | 250 | 20,0 | ? | Gemessen von Ebayer |
| 1 x braun | 7H8 511 115C (6) | 250 (7) 260 |
22,0 (1) | ? |
22,0: Messung 1 ausCaliboard 22,3: gemessen von Ebayer (1) |
| 2 x braun | 7H8 511 115D | 250 (7) 260 |
21,9 (0,3) | 110 | |
| 3 x grau | 7J0 511 115F | 250 | 21,8 (4) | Caliboard | |
| 4 x grau | 7J0 511 115G | 265 | 21,5 (0,5) | 162 | "Nachher" bei mir |
| 4 x rosa | 7H5 511 115L | 260 | 22,0 (0) 21,3 |
162 | Effekt (2) |
Schlauchstutzen eingesetzt in den
aufschraubbaren Wassertankdeckel (die Verschraubung noch mit Kleber
abgedichtet): |
 |
Ansicht von unten / innen: |






 |
 |




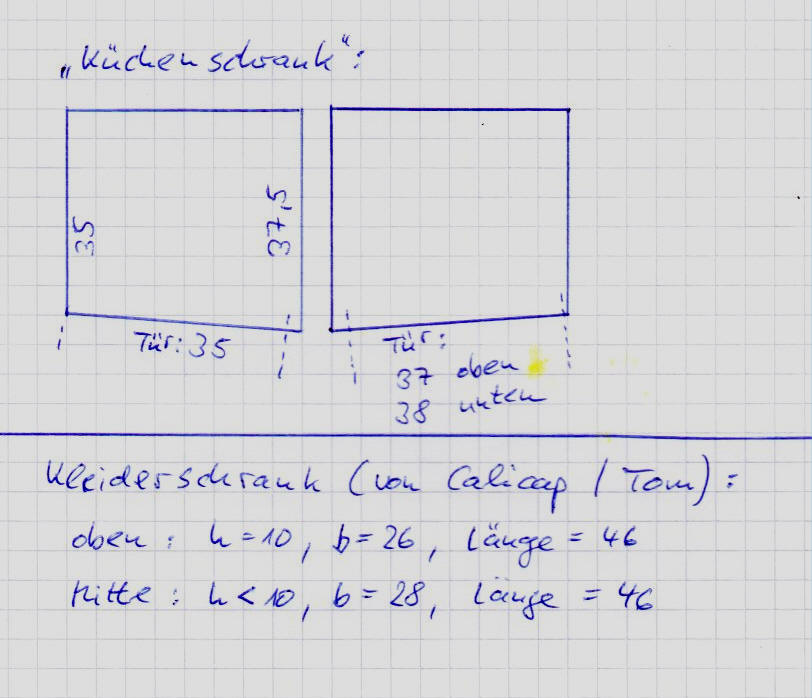




.jpg)




| Butan ("Camping Gaz") Flasche "D907" |
Propan | |
| Flasche leer ("Tara") | 3,7 kg | 3,6 kg |
| Flasche 100% voll (gewogen) | 6,6 kg | 6,1 kg |
| Gasfüllung rechnerisch (gewogen) | 2,9 kg | 2,5 kg |
| Gasfüllung angegeben | 2,75 kg | 2,5 kg |









| Bezeichnung | ET-Nr. | Prüfen / Bemerkung | ... |
| KRR | 03L 903 137 AC (geänderte Ausführung, gemäß TPI 2041442/1) |
Auslegung auf 120.000 km Lebensdauer. Auf korrekte Verlegung achten: Verlauf und Lage auf den Rollen. |
|
| alle Riemenscheiben | prüfen: Kanten scharfkantig? | ||
| Spannelement | 038 903 315 AP | Zum Wechsel des Spannelementes muß
der Klimakompressor gelockert und die Drehmomentstütze demontiert
werden. VWN-Vorgabe ist, das Spannelement beim KRR-Wechsel stets mit zu wechseln. |
|
| Lima-Freilauf | 045103119A | Auslegung auf 120.000 km Lebensdauer. Es gibt ein Gleichteil von
SKF. prüfen: bei demontiertem Riemen bzw. nach Motorstopp muss der Lima-Rotor frei "nachdrehen". Dabei auch auf Lagergeräusche achten. Man kann den Freilauf auch bei eingebautem Riemen prüfen: nach dem Abnehmen des Staubschutzdeckels muss sich die Welle der Lima mit dem Demontagewerkzeug (erforderlich) im Uhrzeigersinn frei drehen lassen. Entgegen dem Uhzeigersinn sperrt der Freilauf. |
|
| Umlenkrolle | 03L 145 276 C | Baugleich und viel günstiger soll sein: SKF VKM 31008 | |
| Klimakompressor | prüfen: von Hand durchdrehen und auf Auffälligkeiten des
Rollenlagers in der Riemenscheibe achten. Falls der Klimakompressor einmal "festgeht", sollte eine Überlastsicherung innerhalb der Riemenscheibe abscheren und weiteren Schaden verhindern. |
||
| Servolenkungspumpe | prüfen: sollte sich von Hand frei durchdrehen lassen. Ist das Öl sauber, hat es vor dem Riemenschaden "Lenkaussetzer" gegeben? |



| Baugruppe (Modell T5.2!) | Intervall [km] (1) | Menge [ml] | Sorte | Zubehör / Bemerkung |
| DSG | 60.000 | 7200 | G 052 182, G 052 529, G 052 529 A2 (12-20€/l), VW ~25-30€, Mannol DCT Getriebeöl 8202, Febi | beim T5.2 DSG DQ-500 gibts 2 Ölablasschrauben: 1. Schraube = 6000 ml, 2. an der Mechatronik: +1200 ml |
| Filter an der DSG-Pumpe | 60.000 | reinigen | ||
| DSG-Ölfilterwechsel | 120.000 | angeblich Lifetime. | ||
| Winkelgetriebe (vorne) | 750 | VW: G 052 518 A2, = 75W-80 (API GL 4), synthetisch (16-30 €/l) | bei Wechsel ca, 800 ml. Einfüllschraube m. Dichtring N 902 818 02, Dichtring f. Ablassschraube N 013 844 4 | |
| Haldex 4 | 30.000 | 1000 | FeBi Spezialöl, VW G 055 175 A2 | Einfüllschraube m. Dichtring N 902 818 02, Ablassschraube N 910 827 01 |
| Haldex-Ölfilter | 60.000 | Beim T6 gibt's keinen Ölfilter mehr. | ||
| Haldex-Vorlade-Pumpe | 30.000 | nur das Sieb reinigen | ||
| Differential hinten | 100.000 | 1200 | Castrol Syntrax Longlife 75W-90, API GL-5, VW: G 052 145 S2, | Einfüllschraube m. Dichtring N 902 818 02. Keine Ablaßschraube? |
(1): die Wechsel-Intervalle sind teilweise von VW, teilweise Empfehlungen aus dem Netz.
























Diese Geschichte ist bei mir dermaßen langwierig und umfangreich geworden, daß eine Feingliederung angezeigt ist. Insgesamt habe ich wegen dieser Thematik über 4 Wochen Ausfallzeit gehabt, und in der Summe 5 Fahrten zur und von diversen Werkstätten. Und 1300€ Kosten.

 |
 |
| Hätte ich diese Bilder vorher gesehen
|
|


| 🡫 hier kann man die
Schutzfolie erahnen, die gegen das Reiben der Dichtlippe angebracht wurde. Wobei: die "Hauptreibung" findet im senkrechten Teil statt, nicht im waagrechten! Der senkrechte Teil wird nicht geschützt durch die Folie, der freiliegende Kitt zwischen Kappe und Rumpf wird immer noch durch die Dichtung "berubbelt". Ebenso erkennt man, daß der Spalt wieder deutlich enger eingestellt wurde. Vgl. oben.  |
 |
Die senkrechte Fuge wird nicht geschützt durch die Folie, der
Kitt zwischen Kappe und Rumpf liegt nach wie vor offen und wird durch
die Dichtung "berubbelt". |

 |
1. Hydraulikpumpenmotor 2. Radialkolbenpumpe 3. Wechselventil 4. Ölbehälter 5. Überdruckventil (180 +10/-5 bar) 6. Überdruckventil (100 +10/-5 bar) 7. Rückschlagventil 8. Drossel 0,8 mm im Pumpgehause 9. Fördermengeverteiler schliessen 10. Fördermengeverteiler heben 11. gesteuertes Rückschlagventil 12. gesteuertes Rückschlagventil 13. Rückschlagventil 14. Rückschlagventil 15. Überdruckventil (160 +10/-5 bar) 16. Überdruckventil (160 +10/-5 bar) 17. Notbetätigungsventil 18. Zylinder links 19. Zylinder rechts 20. gesteuertes Rückschlagventil |


 |
 |
| Austritt in den Wasserkasten rechts: ist eh nicht
gerade eine große Öffnung |
Austritt in den Wasserkasten linke Seite: man erkennt das Kabel und erahnt die Verengung. Gibt man von oben gleichviel Wasser drauf, läuft es allerdings rechts und links gleichschnell ab. Trotzdem, umso mehr: => regelmäßig durchspülen! |














 ...!
...!

| Neue (2-teilige) und alte
Ausführung im Vergleich. Die "Dichtlippe" ist garantiert teurer als
der Moosgummiring! Um die linke neue Ausführung einsetzen zu können, muß zuvor Ober- und Unterteil getrennt werden. Das kleine Unterteil wird dann zuerst ins Blech eingesetzt, und in dieses kommt dann der Zapfen des größeren Teils zu liegen. |
|
 |
|
| Um das "Basisteil" vom "Oberteil" zu trennen, muß man vorsichtig so ansetzen. Gibt Zug nach oben: | ... und dann mit einem kleinen Schraubendreher hier "einspuren" und dann "auflöffeln", damit der untere Zapfen raus kann. |
 |
 |
| Dabei Kerbe in diese Richtung zeigen lassen: | ... und wenn es gut ging, dann so die beiden Teile voneinander ziehen: |
 |
 |
| Wie gesagt: damit verbringt man schon mal die erste Viertelstunde. Und das untere Teil der Clips sieht nach dieser Prozedur im Grunde schon recht kaputt aus. | |















